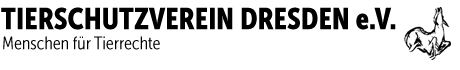Durch eine zunehmende Spezialisierung der Landwirtschaft und die Konzentration auf große Schlachthöfe werden Nutztiere wiederholt und teilweise auch über größere Strecken hinweg transportiert. So kommt ein Mastschwein in einem Sauen-haltenden Betrieb zur Welt, wird dann nach drei bis vier Wochen zu einem Ferkelaufzuchtbetrieb und von dort im Alter von neun bis zehn Wochen zum Mastbetrieb transportiert. In diesem wird es in rund 90 Tagen gemästet, bis es dann seinen Transport zum Schlachthof antritt. Bei Rindern und Geflügel sieht es ähnlich aus. So werden nach den aktuellen Statistiken über Dreiviertel aller Nutztiere transportiert.
Dazu kommen es noch, in deutlich kleineren Relationen, Langstreckenexporte in entfernte Länder wie nach Nordafrika, nach Osteuropa oder den mittleren Osten. Diese erfolgen meist per LKW. Die EU-Transport-Verordnung und ihre Durchführungsverordnung in Deutschland sollen dies regeln, sind aber zumeist recht weit gefasst und schwammig formuliert, sodass selbst diese Standards nur sehr bedingt eingehalten werden. So sind die Fahrzeuge auf dem Papier zwar entsprechend ausgerüstet, aber inwieweit diese Regelungen – gerade außerhalb des Bereichs der europäischen Union – eingehalten werden, ist nicht zu kontrollieren.
Bei der Schlachtung von Nutztieren ist eine vorherige Betäubung gesetzlich vorgeschrieben. In der praktischen Umsetzung, gerade in den großen Schlachthöfen mit einer faktischen Tötung im Fließbandverfahren, gelingt die Umsetzung tragischerweise nicht immer. Die gängigsten Betäubungsverfahren sind:
- Beim Bolzenschuss wird dem Tier – meist Rinder und Schafe – mittels Bolzenschussgerät ein Bolzen durch den Schädel in das Gehirn geschossen. Das Tier erleidet eine Gehirnerschütterung und Teile des Gehirns werden zerstört, ehe es bewusstlos zusammenbricht. Dies alles geschieht in der sogenannten Fixationsbox, aus der zur besseren Fixierung nur der Kopf des Tieres herausschaut.
- Mittels Strom werden die Tiere vor der eigentlichen Schlachtung betäubt. Bei Schweinen und Schafen wird mit einer stromführenden Zange die Gehirnfunktion vorübergehend ausgeschaltet und ein epileptischer Anfall ausgelöst. Hühner und Puten werden an ihren Füßen aufgehängt und anschließend kopfüber in ein Wasserbad, durch das Strom fließt, getaucht.
- Mittels Kohlendioxid werden die meisten Schweine, aber auch immer öfter Geflügel, vor der Tötung betäubt. Dazu werden die Tiere in eine Art Aufzugsystem getrieben und in das Gas hinabgefahren.
- Bei Hausschlachtungen ist es hingegen gesetzlich erlaubt, kleinere Tiere wie Kaninchen, Geflügel oder Tierkinder mit einem harten Schlag auf den Kopf zu betäuben.
- Beim Schächten – als Ausnahmeregelung aus religiösen Gründen – werden die Tiere hingegen ohne Betäubung getötet.
Alle diese Betäubungsmethoden haben jedoch eines gemeinsam: Ihre praktische Umsetzung gelingt nicht immer so, wie es auf dem Papier festgelegt wurde. Viele Bolzenschüsse gehen daneben, die Strombäder betäuben nicht sicher jedes Tier und Gas wirkt auch nicht immer genügend. Das bedeutet, dass viele Tiere bei vollem Bewusstsein und in völliger Panik den Todesstoß oder -schnitt mitbekommen, im wachen Zustand ausbluten oder geköpft werden! Zudem werden sie am Fließband abgefertigt, sodass ihre Artgenossen jeden Todesschrei mitbekommen und somit in völlige Panik versetzt werden.
Nach erfolgter Betäubung werden die Tiere an den Beinen aufgehängt. Danach werden sie „gestochen“, damit sie ausbluten und versterben. Dies erfolgt durch einen Einstich mit dem Messer in den Halsbereich, um die dortigen großen Blutgefäße zu öffnen. Anschließend wird die Haut angeschnitten und abgezogen bzw. Schweine zuerst in einem heißen Wasserbad gebrüht, damit die Borsten und die oberste Hautschicht leichter entfernt werden kann oder bei Geflügel die Federn entfernt. Danach wird der Bauchraum geöffnet und die Eingeweide werden entfernt, bevor die Tiere weiter zerlegt werden. Durch die fehlerhafte Betäubung ist dieser Tötungsprozess jedoch häufig unvorstellbar qualvoll! Man schätzt, dass gut zehn Prozent den Vorgang der Schlachtung noch bewusst erleben.
Hausschlachtungen verlaufen dagegen oftmals leidfreier, da die Tiere sicher betäubt und zügig getötet werden. Die Tiere haben keine langen Transportwege und dadurch weniger Stress, was sich wiederum positiv auf die Fleischqualität auswirkt. Doch Fleisch aus artgerechter Haltung mit Hausschlachtung kostet weitaus mehr Geld, als industriell produziertes Fleisch. Da viele Konsumenten aber ihre tägliche Fleischportion lieben, können sich solche hohen Qualitätspreise noch nicht vollständig durchsetzen. Wer weiterhin Fleisch konsumieren möchte, sollte dennoch auf die Haltungs- und Schlachtbedingungen achten und lieber etwas mehr Geld ausgeben. Wenn tägliche Fleischkonsum (Achtung: verarbeitete Wurst ist ebenso Fleisch) überdacht wird, spielt das Geld beim Einkaufen eine geringere Rolle.