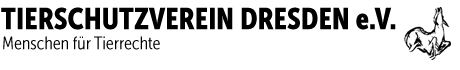Tiere zu halten gehört für viele Menschen zu einem erfüllten Leben. Jedoch kann jedes Tier, gleich welcher Größe, durch sein natürliches Verhalten Schäden anrichten, für die Herrchen oder Frauchen letztendlich aufkommen muss. § 833 Satz 1 des BGB über die Haftung des Tierhalters lautet: „Wird durch ein Tier ein Mensch getötet oder der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist derjenige, welcher das Tier hält, verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.“ Das bedeutet, dass Tierhalter*innen automatisch für die Schäden haften, die durch ihr Tier entstehen und unbegrenzt schadenersatz- und schmerzensgeldpflichtig sind, auch ohne eigenes Verschulden (sog. Gefährdungshaftung). Bei Nutztieren wie Milchkühen müssen Halter*innen nur haften, wenn sie ihre Sorgfaltspflicht vernachlässigt haben und es aufgrund dieses Verschuldens zum Schadensfall kommt. Ebenso bei Tieren, welche dem Beruf, dem Erwerb oder dem Unterhalt des*der Besitzer*in dienen wie Polizeipferde, Hüte- oder Blindenhunde.
Im Haftungsfall ist es grundsätzlich nicht relevant, wem das Tier gehört (Tierhalter*in), sondern wer zum Zeitpunkt des Schadensfalls die Gewalt über das Tier hatte (Tieraufseher*in). Auch Personen, die professionelle Gassi gehen oder über eine Reitbeteiligung reiten, übernehmen somit die Tierverantwortung, jedoch gelten hier unter Umständen Abstufungen in den Haftungen und dem Mitverschulden. Wesentlich ist eher der Kausalzusammenhang, was bedeutet, dass es nicht entscheidend ist, wie und warum sich das Tier so verhalten hat, wie es sich verhalten hat, sondern, dass das Verhalten des Tieres ursächlich für den Schadenseintritt war (Tiergefahr). Beispiele für Situationen, in denen gerichtlich gegen den Tierhalter entschieden wurde, sind der Sturz einer Passantin über einen schlafenden Hund vor einem Ladengeschäft, der Sturz eines Fahrradfahrers, weil er sich über einen bellenden, angeleinten Hund erschrocken hatte oder der Sturz einer Katzenhalterin beim Versuch ihre Katze vor dem Angriff des Nachbarhundes zu schützen.
Schäden in Mietwohnungen, die durch Haustiere entstehen, wie verkratzte Wände oder Türstöcke sind nicht unüblich, daher dürfen Hunde und Katzen nur mit Zustimmung des*der Vermieter*in einziehen. Kleintiere wie Kaninchen, Hamster oder Wellensittiche dürfen ohne Einschränkung gehalten werden. Für Schäden durch Tierkot oder -urin sowie tiefe Kratzer im Bodenbelag sind Halter*innen schadenersatzpflichtig. Leichte Kratzer hingegen werden den üblichen Abnutzungserscheinungen zugeschreiben, welche Vermieter*innen akzeptieren müssen.
Um Sach- oder Personenschäden sowie Schmerzensgeld und sonstige Kosten nicht aus eigener Tasche zahlen zu müssen, können spezielle Tierhaftpflichtversicherungen abgeschlossen werden, auch für beispielsweise Pferde. Die übliche Privathaftpflichtversicherung deckt im Regelfall Schäden durch Katzen und Kleintiere ab, für Hunde ist eine Hundehaftpflichtversicherung empfehlenswert und in einigen Bundesländern bereits vorgeschrieben. Die Kosten variieren dabei für verschiedene Hunderassen. In bestimmten Situationen oder bei besonderen Tieren kann sich die Haftung im Einzelfall abweichend darstellen. Eine konkrete Auskunft und Beratung bei Anwaltskanzleien oder Versicherungsgesellschaften ist daher ratsam.
Weitere Informationen finden sich auch in folgenden Quellen:
- https://www.tierimrecht.org/de/recht/lexikon-tierschutzrecht/Haftung/
- https://www.anwalt.org/tierhalterhaftung/
- https://www.test.de/Tierhalterhaftpflicht-Alles-was-Tierhalter-wissen-muessen-5767254-0/
- https://www.roland-rechtsschutz.de/tierhalterhaftung/